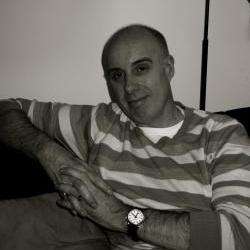Mit dem Aufkommen des Tonfilms in den 1930ern kam auch die Notwendigkeit von Orchestermusik, die die zusehends ambitionierten Bilder begleiten würde. Aber wer sollte sie schreiben? Filmmusikspezialisten wie John Williams und John Barry gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die Welt der Melodien und Arrangeure der musikalischen Komödie passte zu Judy Garland/Mickey Rooney-Filmen, doch sie konnten den Anforderungen der ernsten, großen Filme nicht genügen, deren Produktion stetig zunahm. Die Lösung für dieses Problem lag auf der Hand: Man wandte sich an klassische Komponisten, um der Musik das nötige Gewicht zu geben. Das führte dazu, dass Komponisten wie Prokofjew und Schostakowitsch in Russland und Milhaud und Honegger in Frankreich rekrutiert wurden, während Hollywood Komponisten wie Erich Korngold und Max Steiner aus Europa einfliegen ließ.
Das gleiche galt für Großbritannien, und einer der ersten Komponisten, die für das Schreiben für Filmmusik angeworben wurde, war Arthur Bliss. Seine Musik zu Was kommen wird (im Original Things To Come, 1936) war zu dieser Zeit womöglich die anspruchsvollste Produktion des britischen Tonfilms. Mit einem Skript von H. G. Wells und ausgedacht vom menschlichen Kraftwerk Alexander Korda war hier eine Musik von beträchtlicher Substanz von Nöten, um das Projekt abzurunden.
Was sie dafür von Bliss bekamen, dessen Karriere sich zu dieser Zeit auf ihrem Höhepunkt befand, war vielleicht sein bestes Werk, denn die Musik ist so kraftvoll, dass man sie oft als wichtigste britische Filmmusik gelobt hat, die je geschrieben wurde. Als einziges Problem erwies sich die Qualität der Partitur an sich, denn es ist die Musik, nicht der Film, an den man sich erinnert. Die beste Filmmusik unterstützt die Gesamtproduktion und überlagert sie nicht, was Komponisten wie Bernard Hermann nur allzu bewusst war. Nicht, dass man Bliss die Schuld daran geben könnte; zu diesem frühen Zeitpunkt in der Entwicklung der Filmmusik mussten diese kreativen Feinheiten erst noch ausgearbeitet werden.
Es bleibt jedoch ein Mysterium, warum diese fabelhafte Musik aus dem Konzertsaal verschwunden ist – wie praktisch alle von Bliss' Werken. Eine mögliche Erklärung könnte die Tatsache sein, dass der Snobismus bezüglich „ernster“ Komponisten gab, die für den Film geschrieben haben? Ein Artikel über Vaughan Williams' Musik aus dem 1980ern bestätigt diese Vermutung. Er teilte seine Musik in zwei Kategorien, vor und nach seiner ersten Filmmusik 49th Parallel (1940/1941). Das Argument hierfür war, dass diese anspruchslose Kompositionsform die Reinheit seiner Musik hoffnungslos infiziert habe. Die Fünfte Symphonie (1943) beispielsweise sei eine billige, „infizierte“ Version seiner Pastoral-Symphonie; gleiches gelte für die Vierte (1934) und Sechste (1947) Symphonie. Dieser Erzfeind von Vaughan Williams' Größe war der Schrecken der Symphonia Antarctica (1952), die auf der Musik für Scotts letzte Fahrt (Scott of the Antarctic, 1948).
Die Zeit hat gezeigt, dass diese Analyse in Bezug auf Vaughan Williams unberechtigt war, denn seine Bekanntheit wuchs, seinem Ausflug in die „schmuddelige“ Welt des Filmes zum Trotz. Man könnte jedoch behaupten, dass es William Walton in dieser Hinsicht nicht so gut ergangen ist. Die Reihen an Werken, die vor seiner Filmmusik entstanden war, hatte ihm einen sicheren Platz in den Konzertsälen verschafft, doch die Kompositioen, die seiner ersten Filmmusik zu The First of the Few (1942) folgten, werden deutlich seltener gespielt und sind weniger beliebt. Wie oft findet man Werke wie die Zweite Symphonie, die Variationen über einThema von Hindemith, das Capriccio burlesco oder die Improvisationen über ein Impromptu von Benjamin Britten auf einem Konzertprogramm? Nur das Cellokonzert konnte sich zaghaft im Repertoire etablieren.
Für viele Komponisten war die Verlockung eines guten Einkommens groß. Paradebeispiele hierfür sind die so gut wie vergessenen Serialisten Humphrey Searle und Elizabeth Lutyens, die ihre Rechnungen mit dem Komponieren für Musik für „Hammer Horror“-Filme bezahlten, während sie einige der am stärksten avantgardistisch geprägten Werke ihrer Zeit schrieben. Lutyens gelang es sogar, eine der angesehensten britischen Komponistinnen er 1960 zu werden, obwohl sie zu gleicher Zeit die Musik zu Der Fluch von Siniestro (The Curse of the Werewolf, 1961) beisteuerte. Als Tochter des Architekten Sir Edwin Luytens war Kreativität für sie so etwas wie ein Geburtsrecht, doch leider verschwand auch ihre Musik aus den Konzertsälen und sogar den Aufnahmestudios.
Die wahren Opfer des Filmmusik-Snobismus allerdings waren Komponisten wie William Alwyn und Malcolm Arnold, die ihre Konzertambitionen erst noch erreichen mussten, und deren Konzertstil eine Erweiterung ihrer Filmmusik war. Beide waren enorm erfolgreiche und anerkannte Filmmusikkomponisten, Arnold war erst der zweite britische Komponist nach Brian Easdale, der für seine Musik zu David Leans Die Brücke am Kwai (The Bridge on the River Kwai, 1957) einen Oscar gewann.
Arnold schrieb 116 Filmmusiken, verfiel dabei dem Alkohol und durchlebte eine Reihe von Zusammenbrüchen und Selbstmordversuchen. Traurigerweise wurden seine Konzertwerke, einschließlich einer herrlichen Neunten Symphonie, dauerhaft ignoriert und werden bis heute nur sehr selten aufgeführt, obgleich seine Symphonien den vielleicht beeindruckendsten britischen Symphonie-Zyklus nach Vaugham Williams' neun darstellen. Arnold war auf ewig „infiziert“ vom Populismus und ist es tatsächlich bis heute geblieben.
Das Zeitalter der „ernsten“ britischen Komponisten, die für den Film schreiben, ist wirklich und wahrhaftig vorbei, mit der Ausnahme von Michael Nyman, der das gleiche Schicksal erlit wie Malcolm Arnold. Jetzt haben wir eine Armee an Komponisten, die sich auf dieses Genre spezialisiert haben, und die eine Menge nützlicher und professioneller Musik in einer Vielzahl an Stilen produzieren. Und doch gibt es diese Momente, in denen man sich nach einer großartigen Melodie oder einer düster-verstörenden Atmosphäre sehnt, die von einem Komponisten stammt, dessen Kunst sein Leben und nicht sein Handwerk ist.
Aus dem Englischen übertragen von Hedy Mühleck