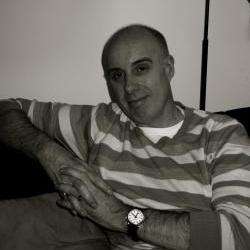Sibelius schrieb an einen Freund: „Nachdem er meine Dritte Symphonie gehört hatte, schüttelte Rimsky-Korsakow den Kopf und sagte: 'Warum machen Sie es nicht wie gewöhnlich; Sie werden sehen, dass das Publikum dem nicht folgen oder es verstehen kann.'“ Derartige Kommentare sind beispielhaft für die kritische Reaktion auf diese Symphonie wie auf die Vierte. Beide Werke verwirrten ihr erstes Publikum. „Alles war so seltsam“, berichtete der finnische Kritiker Heikki Klemetti nach der Uraufführung der Vierten, und beide Werke sind bis heute die am wenigsten aufgeführten des symphonischen Zyklus geblieben. Im Laufe der Zeit jedoch haben Kritiker die außergewöhnlichen Stärken beider Werke erkannt, die weniger darauf zielen, dem Publikum zu gefallen, und sich mehr damit befassen, neue Möglichkeiten des symphonischen Ausdrucks aufzutun.
Bei der Uraufführung der Dritten Symphonie 1907 stand ihre Zurückhaltung, oft als „klassisch“ bezeichnet, im starken Gegensatz zur überzeichneten Romantik bzw. zum Expressionismus ihrer Zeit. Eine Öffentlichkeit, die erst kürzlich die hysterischen Exzesse einer Strauss'schen Salome erlebt hatte, war von diesem bescheidenen Werk nur wenig beeindruckt. Nur sehr wenige Kritiker sahen das Stück als Aufbruch in neue Gefilde, sondern vielmehr als Verlust von Inspiration nach der beliebten Zweiten Symphonie. Rückblickend sieht man, dass die Dritte eigentlich die erste wirklich „Sibelianische“ seiner Symphonien ist und in ihr viele seiner Ideen in harmonischer Sprache, melodischer Entwicklung und formaler Prägnanz zum ersten Mal auftreten.
Zu dieser Zeit suchte Sibelius, wie viele andere Komponisten musikalisch gesehen kleinerer Nationen, sich von den stilistischen Einflüssen der deutschen, französischen und russischen Schulen zu lösen. Kodály und Bartók in Ungarn, Janáček in Böhmen und Vaughan Williams in England fand Sibelius sich von den Fesseln eines Wagner oder Tschaikowsky befreit, indem er die Landschaft, Mythologie und musikalische Folklore seiner Heimat als Inspiration nutzte. Mit der Dritten Symphonie gelang ihm ein glatter Bruch mit diesen anderen, dominanten Stilen.
Die Symphonie teilt sich in drei Sätze, deren letzter effektiv ein Scherzo und Finale in einem sind. Konservative Orchesterbesetzung verhilft zu klarer Textur und Sibelius selbst sagte zu einem späteren Zeitpunkt, er selbst bevorzuge ein kleines Streicherregister, um die Transparenz der Orchestrierung zu betonen.
Der erste Satz, ein Allegro moderato in C-Dur, ist sicherlich einer der klarsten, effektivsten Sonatensätze seit Beethoven, dessen Referenzen zum 20. Jahrhundert in den markanten Modulationen und subtilem Einsatz von Tritoni zur Spannungserzeugung liegen.
Das langsame Andantino con moto, quasi allegretto im weit entfernten gis-Moll ist eine von Sibelius' schönsten Kreationen. Das einfache Kopfthema kehrt viermal zurück, unvariiert, nur dezent verziert, und deutet auf eine lose Rondostruktur. Der Effekt dieser melodischen Eleganz und Haltung zieht starke Parallele zu Schubert.
Der letzte Satz, ein Moderato, beginnt mit huschenden Figuren und instabilen Harmonien, die zu einem Höhepunkt leiten. Als sich dieser Ausbruch beruhigt, zeigt sich darin allmählich ein marschähnliches Choralthema, das zu einem prächtigen Höhepunkt aufgebaut wird und abrupt aber überzeugend mit einer einfachen C-Dur-Kadenz endet. Dieser Übergang von „Scherzo“-Musik zum Choral ist der wunderbarste Moment der ganzen Symphonie und bedarf sicherer Handhabe seitens des Dirigenten, um ihm die Balance zwischen Würde und Aufregung zu geben, die er verlangt. Im Konzert jedoch wird sie selten erreicht und kann den Hörer unbefriedigt zurücklassen – und auch ein Grund dafür sein, dass sie Symphonie bis heute nicht die Beliebtheit errungen hat, die sie verdient.
Es heißt, dass die Dunkelheit, die in jeden Ton der Vierten Symphonie sickert, in direkter Verbindung damit steht, dass ihr Komponist mit dem Tode in Form von Kehlkopfkrebs konfrontiert wurde. Der wahre Ursprung ihrer brütenden Atmosphäre, einzigartig sowohl in Sibelius' Schaffen wie dem aller anderer Komponisten, ist jedoch wohl eine Kombination aus mehreren Faktoren. Nach der Komposition der Dritten Symphonie hatte Sibelius Europa bereist, dabei zahlreiche führenden Komponisten der Zeit getroffen und sich mit den Fortschritten in Kompositionstechniken vertraut gemacht, die seine Kollegen vorstellten. Diese Herausforderungen an Tonalität und Rhythmische Ordnung faszinierten Sibelius und stießen ihn gleichzeitig ab, was ihn über den Weg seines eigenen Schaffens in eine Krise stürzte. Es scheint, als wäre die Symphonie eine Art Therapie für den Komponisten gewesen, ein Blick in den Abgrund, der ihm die Motivation schenkte, weiterzumachen.
Das Werk selbst, 1911 uraufgeführt, ist in traditioneller, viersätziger Struktur angelegt, die von einem langsamen ersten Satz eingeleitet wird. Die üppige Verwendung des Tritonus', des diabolus in musica, dominiert alle Sätze. Der erste ist grob in Sonatenform gebaut und besticht durch den ökonomischen Gebrauch des musikalischen Materials und der bassschweren Tiefe des Klanges, bedingt durch die Orchestrierung. Sein ruheloser Charakter wird im Allegro molto vivace weiter entwickelt. Erste Versuche, die Stimmung aufzuhellen, werden von der starken Präsenz der Tritoni unterdrückt und der Satz endet schließlich düster. Das Largo ist wieder eine herausragende Schöpfung, doch anders als der langsame Satz der Dritten Symphonie, der eine idyllische Landschaft zeichnet, ist dieser ein Portrait einer aufgewühlten inneren Landschaft, nur der kürzeste Schimmer von Hoffnung in seiner ekstatischen Klimax. Das Finale (Allegro) scheint einem positiven Kommentar schon näher mit hellem Glockenspiel und Röhrenglocken, doch die dunklen Mächte sind unbezwingbar. Der Höhepunkt ist nihilistisch und die geknechtete Coda bietet keine Lösung.
Sibelius' Dritte und Vierte haben Meinungen gespalten, doch jetzt, betrachtet als Teil eines der großen symphonischen Zyklen, überwiegen ihre Stärke und ihre Schönheit jegliche scheinbare Schwäche bei weitem.
Aus dem Englischen übertragen von Hedy Mühleck.