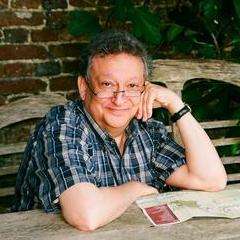Die Überraschung in Massenets Manon der letzten Spielzeit waren die Szenen zwischen Tenor Vittorio Grigòlo und Sopranistin Diana Damrau. Laurent Pellys hässlische, impressionistische Inszenierung beinahe hinter sich lassend, erleuchtete – und erhitzte – das Paar die Bühne mit bemerkenswerten gesanglichen Leistungen und knisternder Chemie. In dieser Saison kehren sie in einer Neuinszenierung von Gounods Roméo et Juliette (Premiere 2008 in Salzburg, dann 2011 in Mailand), wiederholten und festigten ihre intensive Bühnenbeziehung – das waren für den Zuschauer überzeugende Charaktere. Sie hörten einander zu, sie reagierten prompt, sie sangen mit Gefühl und Spontaneität in ihren vier Liebesduetten. Die Oper selbst bleibt natürlich ein etwas schnulziges Machwerk, das sich eher auf schöne Melodien – manche davon außerordentlich schön – stützt als auf emotionale Tiefe, aber ordentlich interpretiert kann daraus ein sehr wirkungsvoller Opernabend werden.
Bartlett Sher hat die Handlung ins 18. Jahrhundert versetzt – warum genau ist schwer zu sagen – und Michael Yeargans Einheitsset, drei Ebenen von Steinsäulen um einen Allzweck-Hof mit einer oder zwei Straßen, ist etwas trostlos und bedrohlich. Doch ein manisches Maskenspiel, viel Bewegung und, in der zweiten Hälfte, ein recht surreales, gigantisches weißes Tuch, das über allem schwebt, mal als Baldachin, mal als Betttuch, dann wieder als Brautschleier, sorgt für Leben auf der Bühne. Große Requisiten werden aus dem Schnürboden herabgelassen, um Räume und Situationen zu formen, und Catherine Zubers extravagante Kostüme sind atemberaubend. Es gibt hier nichts wirklich Neues, was absolut in Ordnung ist. Sher steht der Oper nicht in ihrem eher direkten Weg, konzentriert sich auf die Handlung – die Familien hassen sich, die Liebenden lieben sich. Die Oper in nur zwei Akte aufzuteilen erwies sich als merkwürdig – der erste Akt endete mit der Hochzeit des Paares, ein eher unspektakulärer Moment für den Vorhang. Die alles entscheidende Kampfszene vor dem Palast der Capulets folgte nach einer 35-minütigen Pause, doch das Warten hat sich gelohnt: Kampfchoreograph BH Barry zeichnete hier eher für Aufregung verantwortlich als Herr Sher.
So kann man sich ganz auf den Gesang konzentrieren. Bariton Elliot Madore bot einen ordentlich prahlerischen Mercutio; Laurent Naouris Capulet entwickelte sich von fröhlich und energetisch zu sorgenvoll, immer mit dunklem, schallenden Ton; David Crawford zeigte einen Paris, der Juliette nicht verdient. Virginie Verrez zeigte gute Leistung als Stéphano und Mikhail Petrenkos Frère Laurent war sowohl sanft als auch mysteriös.
Doch alle Augen und Ohren waren auf das Liebespaar gerichtet. Vittorio Grigòlo, dessen Impulsivität und Jungenhaftigkeit in Vorstellungen schon ablenkend gewirkt haben, waren hier ideal: jugendlich, verspielt, liebevoll, reuig und letztendlich tragisch klang er so gut wie er aussah. Elegant und energetisch von einem Ende der Bühne zum anderen springend und wie ein Superstar singend fuhr Grigòlo jedoch nicht ausschließlich auf Volldampf: von einem hinreißenden „Ah, lève-toi soleil“ zu einer bemerkenswert verhaltenen und eleganten Balkonszene hielt er seinen Enthusiasmus im Zaum und zeigte sich als ausgezeichneter, einfühlsamer Sänger und Bühnenpartner. Und er krönte das Duell im dritten Akt mit einem schallenden hohen C gegen die volle Wucht von Chor und Orchester, das das Publikum zur Raserei trieb. Italienisch-französische Tenorkunst in Bestform.
Diana Damraus Klang und Stil ähneln denen Grigòlos kaum. Ihre Stimme ist nicht voll oder warm, aber sie ist eine Künstlerin, die ihre Talente weise und gekonnt einsetzt: sie schwebte auf die Bühne und wurde Juliette (sie ist 30 Jahre älter als ihre Bühnenfigur), ganz unschuldig und aufgeregt, und bot ihr Koloraturschaustück „Je veux vivre“ mit Leichtigkeit und Verve dar. Als ihre Mädchenhaftigkeit im Laufe der Oper zunächst zu Verzagtheit und dann Tragödie wurde, verlieh Damrau ihrem Ton mehr Gewicht und ihre Giftarie, wahrscheinlich der schwerste Moment der Rolle, besaß wunderbare Gravitas. Sie und Grigòlo phrasieren auf die gleiche Weise, geben sich gegenseitig Auftrieb, sind einer Meinung. Das erwies sich als ganz besondere Art des Musizierens.
Gianandrea Noseda leitete Chor und Orchester der Met wirkungsvoll und unterstrich die zahlreichen offensichtlichen Argumente der Oper verständig. Und selbst wenn man sich an diesem Abend eher in einer italienischen Oper wähnte als in einer französischen, so hörte man keine Klagen.
Aus dem Englischen übertragen von Hedy Mühleck.